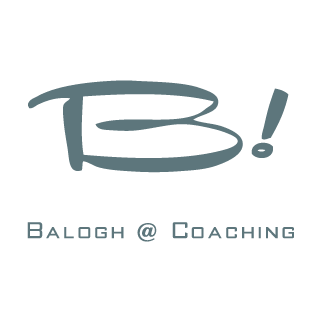Visionen für 2030: "WGs, in denen sich Jung und Alt unterstützen"
Berlin 2030 – Eine Stadt der gelebten Generationenvielfalt
Berlin im Jahr 2030 ist mehr als eine pulsierende Metropole – sie ist eine Modellstadt für generationenübergreifendes Miteinander. Tradition und Innovation verschmelzen mit Erfahrung und Neugier, um eine zukunftsweisende Gesellschaft zu bilden. Eine Stadt, in der keine Generation abgehängt wird, sondern in der Jung und Alt voneinander lernen, sich unterstützen und gemeinsam die Zukunft gestalten.
Neue Wohnformen für ein neues Miteinander
Gemeinschaftliches Wohnen wird ein wichtiges Zukunftsthema sein. In einer Stadt mit extremem Wohnraummangel gibt es viele große Wohnungen, in denen ältere Menschen allein leben. Hier können neue Wohnformen entstehen: Moderne Wohngemeinschaften, in denen sich Jung und Alt gegenseitig unterstützen. Die Älteren profitieren von Gesellschaft und Hilfe im Alltag, die Jüngere erhalten Wohnraum in einer Stadt, in der er immer knapper und teurer wird.
Eine intuitive, benutzerfreundliche App macht es einfach, genau die passenden Wohnpartner:innen zu finden. Das Prinzip bekannter Matching-Plattformen kommt zur Anwendung, jedoch statt Dates werden Wohnpartnerschaften vermittelt. In der App werden freie Wohnräume, die Bedürfnisse und Interessen der Anbieter mit denen der Suchenden abgeglichen. Wer ein oder mehrere Zimmer anzubieten hat, gibt an, was ihm oder ihr wichtig ist: Werte, Unterstützung im Alltag, in Bürokratie und Digitalisierung, in der Gartenpflege, regelmäßige Gesellschaft, teilen von Interessen. Die Suchenden wiederum können ihre Wünsche nach Wohnraum, Lage, gemeinschaftlicher Nutzung von Küche und Wohnzimmer, handwerklichen Fähigkeiten oder gemeinsamen Aktivitäten, mit der zur Verfügung stehenden Zeit pro Woche eingeben. Der intelligente Algorithmus schlägt passende Matches vor.
Kommt ein Match zustande, kann über die App direkt ein Vertrag geschlossen werden, der alle wichtigen Punkte regelt: Vertragslaufzeit – ob für ein Semester oder die Studienzeit –, Kaution, Untervermietung bei Auslandsaufenthalten oder auch Regelungen zum Besuch von Freund:innen, Einzug einer/s Partner:in. Auf Wunsch gibt es den Vertrag auch in Papierform.
Da Digitalisierung nicht für alle selbstverständlich ist und ältere Menschen sie nicht zwangsläufig intuitiv bedienen können, stehen geschulte Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Sie helfen bei der Anmeldung, begleiten den Auswahlprozess und sind auf Wunsch auch beim ersten Treffen dabei. Sicherheit steht an oberster Stelle: Interessenten durchlaufen einen Verifizierungsprozess, bei dem beispielsweise ein polizeiliches Führungszeugnis oder eine Referenz eingeholt wird. So können ältere Menschen mit einem guten Gefühl entscheiden, ob sie ihr Zuhause öffnen.
Auch über den Vertragsabschluss hinaus bleibt die Betreuung bestehen. Eine persönliche Ansprechperson begleitet beide Seiten während der gesamten Wohnpartnerschaft, hält regelmäßig Kontakt und steht bei Fragen oder Konflikten zur Verfügung. Niemand wird allein gelassen.
Diese innovative Wohnform schafft nicht nur bezahlbaren Wohnraum, sondern auch neue Gemeinschaften. Senior:innen, die Gesellschaft und Unterstützung im Alltag wünschen, können ihre großen Wohnungen mit jungen Menschen teilen, die dringend eine Bleibe
suchen. Familien, die eine helfende Hand im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung benötigen, können mit Studierenden oder Alleinstehenden zusammenwohnen. Im Gegenzug profitieren diese Menschen von günstigem Wohnraum und einem inspirierenden Austausch zwischen den Generationen.
Eine Win-Win-Situation für alle – und ein großer Schritt in Richtung einer sozialen, nachhaltigen Stadt!
Nachhaltigkeitsstrategie & Umweltprojekte
Ein weiterer Aspekt einer generationsübergreifenden Vorreiterstadt ist die Nachhaltigkeitsstrategie. Schulen und Universitäten arbeiten gezielt mit Ruheständler:innen zusammen, um Umweltprojekte voranzutreiben und zu realisieren. Diese bringen ihre Erfahrungen aus einer Zeit ein, in der Reparieren statt Wegwerfen selbstverständlich war, Ressourcen bewusster genutzt wurden und Selbstversorgung eine große Rolle spielte:
Milch wurde in Milchkannen, später in Pfandflaschen gekauft. Haushaltsgeräte, Kleidung oder Möbel wurden repariert, anstatt sie zu ersetzen. Es gab weniger „Wegwerfmentalität“. Lebensmittel wurden saisonal und regional konsumiert, Importwaren waren teurer und seltener. Ein bewussterer Umgang mit Heizung und Licht führten zu einem niedrigeren Energieverbrauch. Es wurden weniger Elektrogeräte benutzt und die Wohnflächen pro Person waren kleiner.
Im Jahr 2030 sind generationsübergreifende Repair-Cafés Gang und gäbe. Sie müssen nicht mühevoll gesucht werden, sondern sind in jedem Quatrier zu finden und werden von Jung und Alt betrieben. In Zusammenarbeit mit Handwerkskammern, Stadtteilzentren, Schulen und Universitäten werden regelmäßig Workshops mit Ehrenamtlichen aus dem Handwerk und der Technikbranche angeboten. Die Bereitstellung von Werkzeug und Materialien erfolgt durch das Sammeln in der eigenen Community, durch Kooperationen mit Unternehmen und durch Spenden.
Gleichzeitig wird an moderner Technologie und innovativen Lösungen für nachhaltiges Leben gearbeitet, wie z.B. Umverpackungen aus Naturmaterialien, ein intelligentes Recycling-System, das Müll automatisch sortieren und wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen kann. Verticales farming bietet frische Lebensmittel auf kleinstem Raum und urbane Kompostierungsprojekte verwandeln Abfälle in nährstoffreiche Erde.
Mit einem kleinen, gut planbaren Projekt, wie z.B. eine Urban-Gardening-Initiative an einer Schule oder einem intelligenten Recycling-System an einer Universität können solche Pilotprojet starten. Erste Erfolge und Erkenntnisse werden über lokale Medien und Social Media kommuniziert, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ein Netzwerk von aktiven Interessenten und Machern zu etablieren und zu erweitern.
Um diese innovativen Projekte auf den Weg zu bringen, bedarf es einer Gruppe von Pionieren, die die Initiative ergreifen und auf Schulen, Universitäten, Unternehmen, Wohlfahrtsverbände und Kommunen zugehen. Aus den Interessierten all dieser Institutionen entsteht ein Nachhaltigkeitsnetzwerk mit Menschen aller Altersgruppen, die diese innovativen Projekte betreuen und vorantreiben. Dieses Netzwerk lebt von klaren Strukturen und Aufgabenverteilungen sowie Kontakten in die lokale Politik und Wirtschaft, zu Verbänden und anderen notwendigen Partnern.
Auch hier kann eine eigens entwickelte App helfen, Akteure zu gewinnen und zu vernetzen, Projekte zu koordinieren, Crowdfunding zu betreiben und Förderprogramme zu identifizieren.
Mein Berlin 2030 ist eine freundliche, tolerante und offene Stadt. Eine Stadt, in der sich traditionelle Werte wie Respekt und Hilfsbereitschaft mit modernen Konzepten und Innovationen verbinden. Das Ergebnis? Eine lebendige, dynamische und zugleich menschliche und lebenswerte Metropole, die für alle da ist - unabhängig vom Geburtsjahr.
Berlin 2030 zeigt, dass echte Zukunftsgestaltung nur gelingt, wenn alle Generationen einbezogen werden – eine Stadt, die voneinander lernt, sich gegenseitig stärkt und gemeinsam wächst.